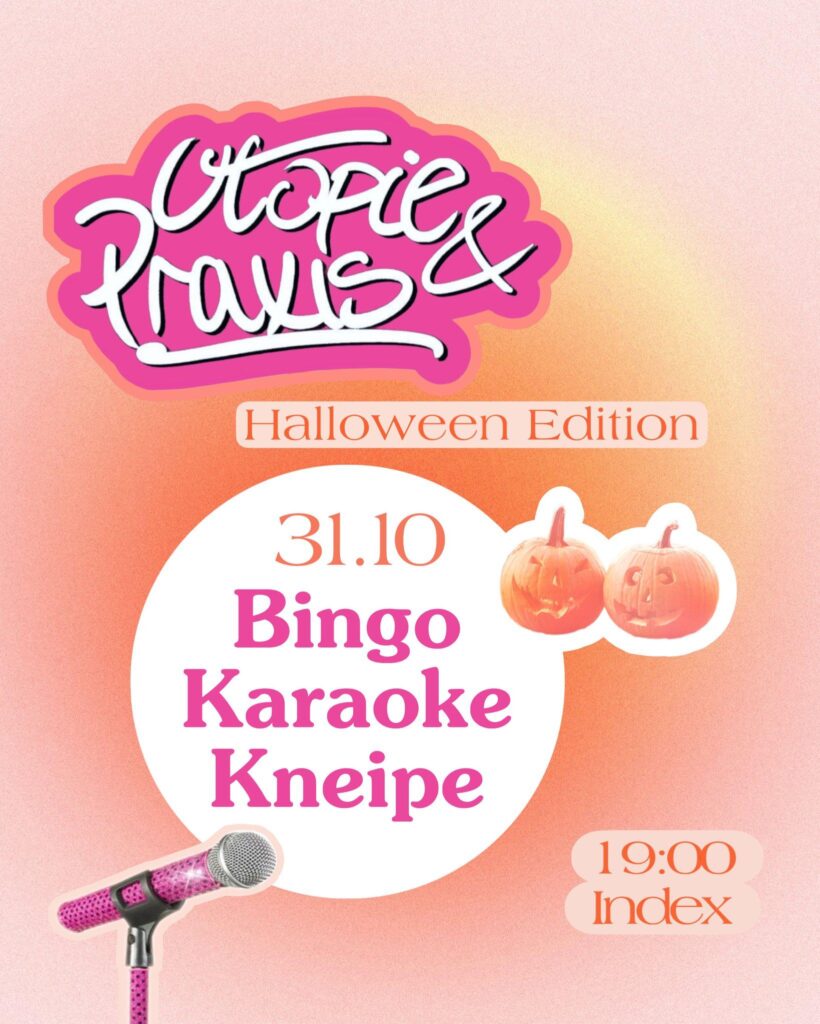
Am 31.10. laden wir zur Kneipe (mit Karaoke) ins Index.
Los gehts um 19:00 und um 21:00 startet die Karaoke.

– linke Gruppe gegen die Verhältnisse
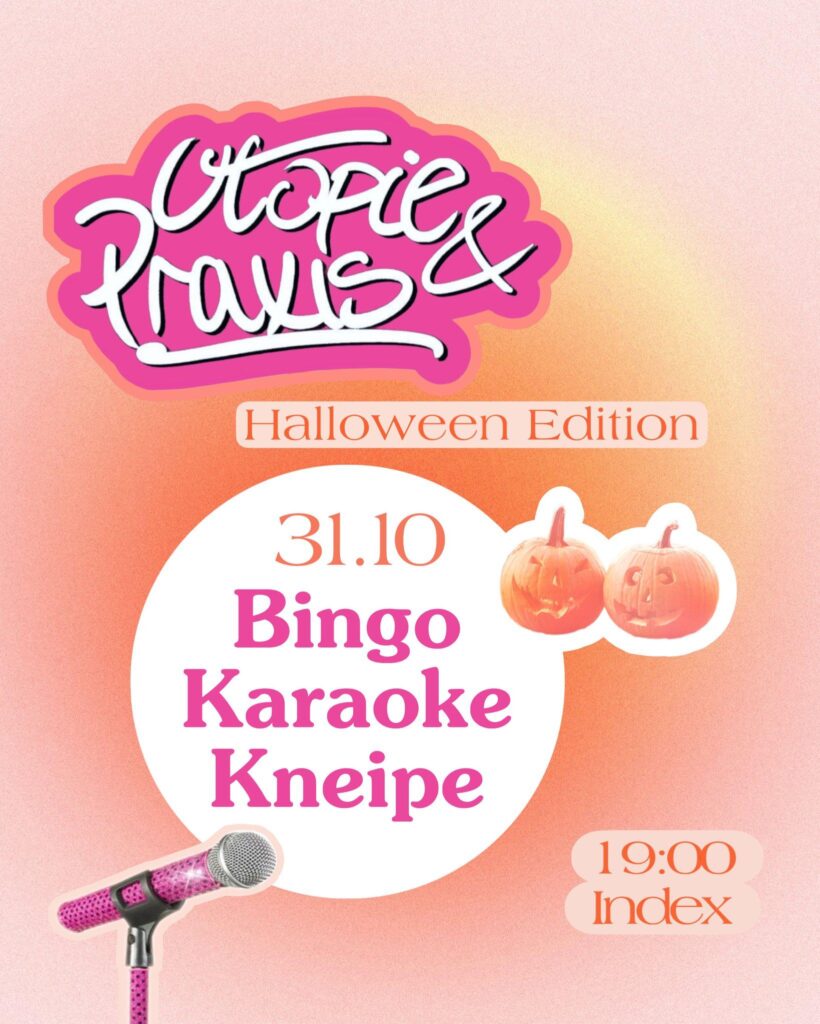
Am 31.10. laden wir zur Kneipe (mit Karaoke) ins Index.
Los gehts um 19:00 und um 21:00 startet die Karaoke.
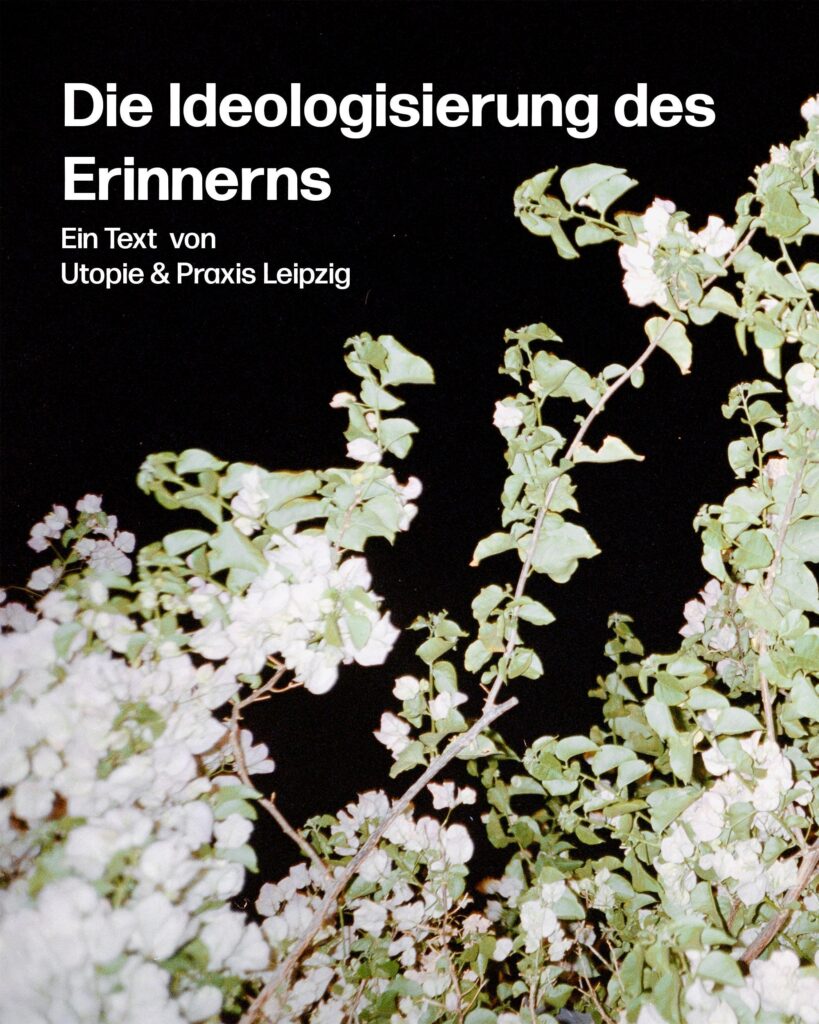
In den frühen 2000er Jahren gewann das öffentliche Gedenken an den Nationalsozialismus zunehmend an Bedeutung. Spätestens mit der Errichtung des “Denkmals für die ermordeten Juden Europas” in Berlin (2005) sollte der Welt ein geläutertes Deutschland präsentiert werden. In dieser kollektiven Selbsttherapie glaubte die deutsche Gesellschaft, ihre Schuld erkannt zu haben und machte dieses Schuldeingeständnis zur Tugend. Mit einer substanziellen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hatte diese öffentliche Zurschaustellung jedoch nichts zu tun. Vielmehr ging es der deutschen Gesellschaft um eine Täter-Opfer-Umkehr. Deutlich wurde dies etwa in den Worten der damaligen Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen2, Erika Steinbach, die im Jahr 2000 erklärte: „Im Grunde genommen ergänzen sich die Themen Juden und Vertriebene miteinander. Dieser entmenschte Rassenwahn hier wie dort, der soll auch Thema in unserem Zentrum sein“3 .
Diese absurde Gleichsetzung sprach vielen Deutschen aus der Seele, wie sich am Beispiel der preisgekrönten Filmreihe “Unsere Mütter, unsere Väter” (2013) verdeutlicht. Hier werden die fünf deutschen Protagonisten letztlich als unpolitische Opfer des Nationalsozialismus inszeniert. In dieser Märchenerzählung dürfen die Deutschen endlich auch mal Opfer sein, denn mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus hatten unsere Groß- und Urgroßeltern ganz sicher nichts zu tun. Diese selektive Darstellung der Deutschen als Opfer, die meist sonst nur klassischen Neonazis bei Trauermärschen vorbehalten war, ist wieder im kollektiven deutschen Gedächtnis verankert.
Die Strategie der Deutschen, die Erinnerung an die Shoah umzudeuten, ist also nicht neu. Erinnert sei an dieser Stelle an Aussagen wie „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte“4. Und weder neu noch überraschend ist das dahinterliegende Motiv: Für jene Rechte, die an die Reinheit der Nation glauben, ist die Anerkennung deutscher Schuld ein identitätszersetzendes Moment. Denn diese Anerkennung widerspricht der Erzählung nationaler Größe sowie der antisemitisch motivierten Relativierung oder Leugnung des Holocausts. Auffällig ist dabei, dass offene Holocaust-Leugnung seltener wird – verbreiteter ist nun die Leugnung der Singularität der Shoah.
Indem die Bombardierung Dresdens oder die Vertreibung der Deutschen als gleichrangige Verbrechen dargestellt werden, wird eine Täter-Opfer-Umkehr vollzogen. Nicht mehr die Opfer des Nationalsozialismus stehen im Zentrum, sondern die vermeintlichen Opfer einer angeblich überzogenen Erinnerungskultur. Die Vorstellung, Deutschland sei eine “Schuldkolonie”, in der historische Verantwortung als Unterdrückungsinstrument dient, hat sich längst aus dem Neonazi-Umfeld in bürgerliche Kreise vorgearbeitet.
Volker Weiß analysiert diesen Ansatz als „rechte Kulturkritik“, die sich gegen die als „aufgezwungen“ empfundene Erinnerungspolitik richtet.5 Der neurechte Verleger Götz Kubitschek, ein enger Vertrauter Höckes, betrachtet die „Geschichtspolitik“ als ein entscheidendes Schlachtfeld, auf dem „unsere Nation an den Abgrund geführt“ worden sei. Kubitscheks Antaios Verlag fördert gezielt das Narrativ eines vermeintlichen „Schuldkults“, das eine kritische Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit als fremdbestimmt und schädlich für das nationale Selbstverständnis darstellt.6 Diese Täter-Opfer-Umkehr dient dabei nicht nur der Entlastung der deutschen Geschichte, sondern bereitet den ideologischen Nährboden für eine Zukunft, in der ein “Nie wieder” die deutsche „Opferschaft“ meint.
Auch an dieser Stelle ein konkretes Beispiel: Im Mai 2020 forderte die AfD im Bundestag die Errichtung einer spezieSonntag12IstBadetag44llen Gedenkstätte für „deutsche Opfer des Zweiten Weltkrieges“. In ihrem Antrag kritisierte sie eine vermeintlich einseitige „Befreiungsrhetorik“ bei offiziellen Gedenkveranstaltungen und argumentierte, das Leid der deutschen Bevölkerung am Kriegsende werde nicht ausreichend gewürdigt.7 Diese Forderung ignoriert jedoch, dass es bereits zahlreiche Denkmäler für deutsche Kriegsopfer gibt, darunter die 1993 eingeweihte “Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ in der Neuen Wache in Berlin. Offenbar scheint deren (durchaus problematische) universelle Ausrichtung, aller Opfer beider Weltkriege zu gedenken, nicht auszureichen, weshalb nun explizit eine eigene Stätte für deutsche Opfer gefordert wird – ein Versuch, die Erinnerungskultur auf das Niveau der unmittelbaren Nachkriegszeit zurückzusetzen, als deutsche Verluste im Mittelpunkt standen.
Fußnoten:
1 Gutte, Rolf; Huisken Freerk (2007): Alles bewältigt nichts begriffen. S.9 [https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/VSA_Gutte_Huisken_Alles_Bewaeltigt_nichts_begriffen.pdf]; weiterführend hierzu: [https://www.akweb.de/ausgaben/701/anti-afd-deutschland-im-herbst-1992-lichterketten-gegen-rechts/].
2 Als Folge des Nationalsozialismus wurden nach Kriegsende Deutsche aus den ehemaligen besetzen Ostgebieten in Polen und der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Die deutsche Minderheiten waren Teil des Germanisierungsplanes des Ostens und häufig bereits seit 1933 Unterstützer*innen des NS-Regimes. Diese Fakten spielen bei der “Eingemeindung der Deutschen auf der Seite der Opfer des Faschismus” häufig keine Rolle. (vgl. Wiegel, Gerd (2021): Auf die Opferseite wechseln. [https://www.akweb.de/gesellschaft/auf-die-opferseite-wechseln/]
3 Steinbach Erika zit. n. Salzborn (2020): Kollektive Unschuld: Die Abwehr der Shoah im Deutschen Erinnern. S. 90.
4 Wortlaut der umstrittenen Passage der Rede von Alexander Gauland. Beim Kongress der Jungen Alternative am 2. Juni 2018 [https://afdbundestag.de/wortlaut-der-umstrittenen-passage-der-rede-von-alexander-gauland/].
5 Weiß, Volker (2021): „Schuldkult“ und „Schuldkolonie“ Tradition und Ziele des aktuellen Geschichtsrevisionismus. [https://www.stiftung-gedenkstaetten.de/reflexionen/reflexionen-2021/schuldkult–und-schuldkolonie].
6 “Meuthen, Parteitag, Höcke“ in: Sezession im Netz v. 1. Dezember, 2020 [https://sezession.de/63663/meuthen-parteitag-hoecke].
7 Der Antrag “Der Trauer um die deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges mit einer Gedenkstätte Ausdruck verleihen” (2020) ist nachzulesen unter [https://dip.bundestag.de/drucksache/der-trauer-um-die-deutschen-opfer-des-zweiten-weltkrieges-mit/241012].
8 Moses, Dirk (2021): Der Katechismus der Deutschen. [https://geschichtedergegenwart.ch/der-katechismus-der-deutschen/].
Hedwig Dohm, Feministin der ersten Frauenbewegung, schrieb schon im 19. Jahrhundert: „Glaube nicht, es muss so sein, weil es so ist und immer so war“. Nach dieser Prämisse haben Feminist*innen seitdem erfolgreich gehandelt. Die feministische Bewegung und ihre Kämpfe sind wirksam darin, nichts für unveränderbar, nichts für ewig, nichts für ein Naturgesetz hinzunehmen. Der Feminismus ist wirksam darin, Ideologien und deren Auswirkungen, die uns das Ewige und Nicht-Veränderbare erst glauben lassen, zu bekämpfen.
Konkret zeigt sich das am Erfolg jahrzehntelanger feministischer Kämpfe:
Die Abschaffung des Paragraf 219a (zum Informationsverbot zu Schwangerschaftsabbrüchen) und damit der Erfolg der feministischen Bewegung, die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen niemals hinzunehmen. Die kurdisch-feministische Bewegung in Rojava kämpft sowohl gegen den IS und die Angriffe der Türkei als auch gegen Patriarchat und Kapitalismus. Die Bewegung kann uns hoffnungsvoll im Bestreben bestärken, die Herrschaftsverhältnisse zu überwinden. Auch das von Feminist*innen erkämpfte Selbstbestimmungsgesetz ist ein wichtiger Schritt im Kampf um die Anerkennung geschlechtlicher Selbstbestimmung.
In Indien streikte landesweit das Krankenhauspersonal, nachdem eine Ärztin im vergangenen Jahr im Krankenhaus vergewaltigt und ermordet wurde. Die Wirksamkeit des Feminismus äußert sich außerdem in Polen, wo eine feministische Bewegung Schwangerschaftsabbrüche trotz staatlicher Repression versucht, möglich zu machen. An all diesen Bespielen zeigt sich, dass feministische Kämpfe uns immer wieder hoffen lassen: Es könnte alles ganz anders sein.
Ob unter Javier Milei in Argentinien, Trump in den USA oder Orban in Ungarn: Für feministische Kämpfe ist im letzten Jahr auch deutlich geworden, dass es die Rechte und die Körper von Frauen, Lesben, inter-, nicht-binären, trans und agender Personen sind, die ein wesentliches Kampffeld (extrem) rechter Politik darstellen. Dabei treten Misogynie und Queerfeindlichkeit gemeinsam zu Tage. In der vor allem von extrem rechten Akteuren verbreiteten Erzählung des Transhumanismus verschränken sich Queer- und Transfeindlichkeit außerdem mit antimodernen und antisemitischen Motiven. Die Verschwörungserzählung des Transhumanismus enthält die Vorstellung, dass es im Sinne einer globalen Elite sei, mittels moderner Technologie die Menschheit auszulöschen.
An den Bildern des Aufmarsches hunderter Neonazis bei CSD-Paraden im letzten Jahr lässt sich erkennen, wie mobilisierungsfähig die rechte Szene auch in Sachsen ist, wenn es gegen queere Menschen geht.
Von Dohm sollten wir deshalb ebenso lernen: Ein feministischer Kampf sollte sich auch anderen menschenfeindlichen Ideologien widmen und diese als miteinander verwoben begreifen. Dohm wies bereits auf den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Sexismus hin. Sexismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, der Hass auf Menschen, die behindert, chronisch krank, obdachlos, arm oder schwach sind – diese Ideologien sind miteinander verschränkt.
Im vergangenen Jahr wurde allerdings deutlich, wie selbst in feministischen Kreisen Misogynie verwoben in antisemitischen Ideologien, auf erschreckende Weise verbreitet wurde: Die brutale sexualisierte Gewalt im Rahmen des islamistischen Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurde geleugnet, verharmlost oder gar als angeblich legitimer Widerstand gefeiert. Gleichzeitig halten wir die in Teilen der Linken vollzogene Idealisierung der rechten Netanjahu-Regierung für fatal. Eine emanzipatorische Linke darf das unfassbare Leid der Palästinenser*innen nicht verharmlosen oder rassistische Narrative sowie rassistische Polizeigewalt verteidigen. Der Kampf gegen Antisemitismus und Misogynie muss mit dem Kampf gegen Rassismus einhergehen.
Hedwig Dohms Vorgabe sollte sich auch eine transfeindlich-feministische Bewegung vorhalten. Trans Frauen leiden unter misogyner Gewalt und unter sexistischen Erzählungen, die auch von manchen Feministinnen befeuert werden. Wenn mit Natur und Biologie deterministisch um sich geworfen wird, wenn sich an vermeintliche Naturgesetze geklammert wird, wenn Identität zu einer starren Notwendigkeit wird, die sich ausschließlich an Genitalien und Gebärfähigkeit orientiert, sollte eine materialistisch-queerfeministische Bewegung deutlich widersprechen. Eine feministische Bewegung, die sich einem biologistisch deterministischen Weltbild bedient und patriarchale Herrschaftsdynamiken personifiziert, richtet sich nicht gegen eine patriarchale Herrschaft oder die Zwänge, die sich aus dieser ergeben, sondern führt wieder in diese zurück. Natur und Gesellschaft müssen von Feminist*innen immer als geworden, als gewachsen und im stetigen Wandel verstanden werden.
Deshalb sollten wir gegen das, was vermeintlich einfach schon immer so ist, stets aufbegehren. Diesen 8. März rufen wir dazu auf, zu kämpfen für das Beharren auf dem Wandel, zu kämpfen für das Anders- und Schwachsein, zu kämpfen gegen die patriarchal-kapitalistische Misere und ihre Ideologien.
Am 06.07.24 laden wir gemeinsam mit OLAfA um 18 Uhr zur Lesung “Queere Literatur und ihre Auslöschung” in die feministische Bibliothek MONAliesA ein. Die Lesung wird einen Einblick in queere Literatur aus der Zwischenkriegszeit bieten und die Vernichtung dieser im Nationalsozialismus, sowie ideologische Nachwirkungen thematisieren.
“I had a chance to read ‘The Well of Loneliness’ that had been translated into Polish before I was taken into the camps. I was a young girl at the time, around twelve or thirteen, and one of the ways I survived in the camp was by remembering that book. I wanted to live long enough to kiss a woman.”


14. Mai 2023 // 13 Uhr // Kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz
Seit Jahren ist der Tag der israelischen Staatsgründung am 14. Mai ein wichtiges Mobilisierungsmoment für die unterschiedlichsten antisemitischen Gruppierungen. In Leipzig, wie in vielen anderen Städten, treffen dabei zu Gedenkdemonstrationen an die sogenannte Nakba kommunistische und islamistische Gruppen zusammen, vereint im eliminatorischen Hass auf Israel. Der drückt sich in Parolen wie “Yallah Intifada” und “from the river to the sea – palestine will be free” aus.
Verschiedene Rote Gruppen wie der Kommunistische Aufbau mit seinen Vorfeldorganisationen Solidaritätsnetzwerk, Frauenkollektiv und Internationale Jugend, Young Struggle, Zora und die Kommunistische Organisation machen seit einigen Monaten regelmäßig mit genau diesen antisemitischen Parolen auf Demonstrationen auf sich aufmerksam. Das lässt sowohl für den Nakba-Tag als auch für zukünftige antisemitische Mobilisierungen eine deutlich höhere Beteiligung aus dem linken Spektrum als noch in den vergangenen Jahren befürchten.
Hier wollen und müssen wir als emanzipatorische radikale Linke intervenieren: Antisemit*innen können niemals Genoss*innen sein. Egal, wie Antisemitismus geäußert wird, er ist immer eine regressive Ideologie, eine falsche, einfache Welterklärung. Das Übel der Welt wird personifiziert – und auslöschbar gemacht. Das führt zu antisemitischen Terroranschlägen, zu gezielten Aktionen gegen Juden und Jüdinnen – aber niemals zur befreiten Gesellschaft.
Antisemitische Parolen werden auf den linken Demos in dieser Stadt immer normaler und autoritär-kommunistische Kleinstgruppen entstehen gefühlt im Minutentakt. Selbst wenn sie meist doch eher wenig Mitglieder haben, ist die massive öffentliche Präsenz autoritär-kommunistischer und antisemitischer Gruppen in der Leipziger Linken etwas, woran wir uns nicht gewöhnen wollen.
Am 14. Mai werden wir ein Zeichen dagegen setzen: An dem Tag, der in den letzten Jahren als Mobilisierungstag für antisemitische Gruppen herhalten musste, werden wir eine eigene Kundgebung veranstalten und zeigen: Es gibt uns noch, die radikale Linke, die nicht komplett in den 1920ern hängengeblieben ist und ein Bewusstsein über Antisemitismus hat. Die sich mit der deutschen Täterschaft im Nationalsozialismus im Allgemeinen, also auch der Täterschaft der Arbeiter*innenklasse, auseinandersetzt, statt diese nur als widerspruchfreies und revolutionäres Subjekt zu verklären. Und die gegen das System des Kapitalismus kämpft, ohne dabei in Regression zu verfallen.
Reclaim Antifa – emanzipatorisch statt antisemitisch
14. Mai 2023 // 13 Uhr // Kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz
Kappa, Utopie & Praxis, Fantifa, Jugend gegen Rechts Leipzig
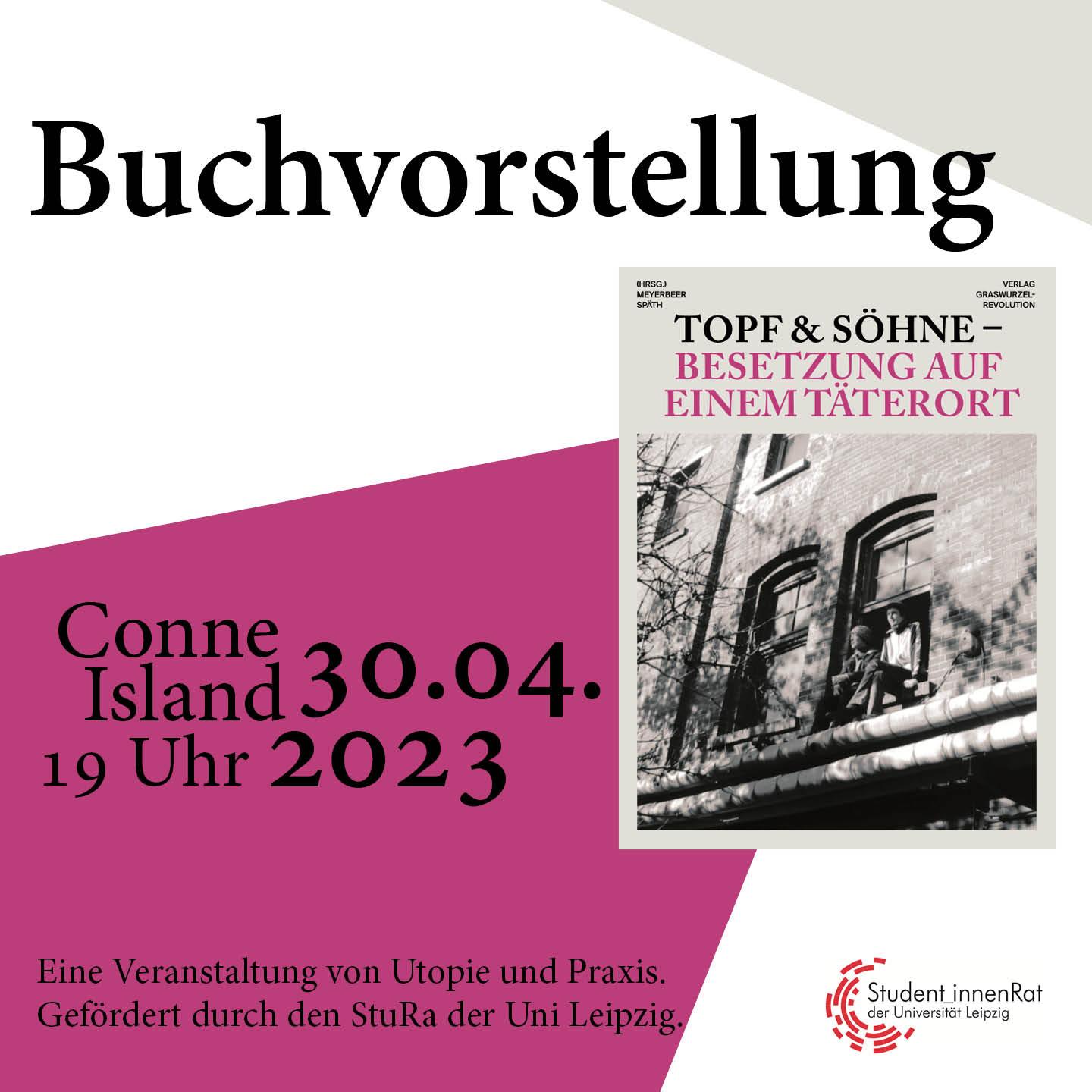
Sonntag, 30.04.2023, Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr
„„Seht her, wir haben so viel aufgearbeitet“ – so hilft Geschichtspolitik dabei, Schuld und Verantwortung unter den Tisch zu kehren.“, prangert Gesa Wolf in einem Beitrag des 2012 erschienenen Sammelbandes „Topf und Söhne – Besetzung auf einem Täterort“ das deutsche Erinnern an. Sie trifft damit einen Punkt, dem sich kritische Formen der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und dessen Fortwirken auch gegenwärtig stellen sollten.
Ab 1939 lieferte die Erfurter Firma „J. A. Topf & Söhne“ Leichenverbrennungsöfen für Konzentrationslager an die SS. Das Unternehmen baute auch für das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau Öfen und Gaskammer-Lüftungstechnik. Eine Aufarbeitung von Seiten der Stadt fand lange Zeit nicht statt. Im Jahr 2001 wurden Teile des Geländes besetzt. Durch die Besetzung, die bis zur Räumung 2009 andauerte, wurde ein selbstverwalteter Ort in Erfurt geschaffen, nachdem zahlreiche Versuche desgleichen gescheitert waren. Von Beginn an wurde sich im Kreise der Besetzer:innen Gedanken um den Umgang mit der Geschichte des Ortes gemacht, was viele Überlegungen und Fragen mit sich brachte. Durch die Thematisierung der Verbrechen mittels der Besetzer:innen konnte ein öffentliches Bewusstsein für die NS-Vergangenheit des Unternehmens errungen werden.
Beteiligte der Besetzung gaben das Buch „Topf und Söhne – Besetzung auf einem Täterort” heraus und dokumentieren damit Konfliktfelder und verschiedene Perspektiven auf die Besetzung. Neben dem Zustandekommen der Besetzung, sollen folgende Aspekte in der Vorstellung und Diskussion des Sammelbandes näher beleuchtet werden: Welcher Anspruch und welche Ansätze wurden bei der Auseinandersetzung mit der Firma Topf & Söhne verfolgt? Welche Erfolge, Hindernisse und Enttäuschungen gab es bei dieser Arbeit und wie gestaltete sich das Verhältnis zu anderen erinnerungspolitischen Akteuren? Wie blicken Teile der Herausgeber:innengruppe heute auf die Zeit der Besetzung und ein staatlich gefördertes Gedenken?
Am 30. April soll das Buch im Conne Island präsentiert werden. Die Veranstaltung wird von Utopie und Praxis Leipzig organisiert und durch den StuRa der Uni Leipzig sowie den FSR Politikwissenschaft der Uni Leipzig gefördert.
Eine Leseprobe ist hier zu finden: https://www.graswurzel.net/gwr/produkt/topf-soehne-besetzung-auf-einem-taeterort/

Zum feministischen und Frauenkampftag wollen wir in diesem Jahr ein Zeichen der Solidarität mit dem anhaltenden Kampf der Aktivist*innen in Iran setzen. Eine solidarische Praktik im Sinne eines feministischen Universalismus bedeutet, die Verflechtungen zwischen feministischen revolutionären Bewegungen zu erkennen und sich darüber mit diesen Bewegungen in Beziehung zu setzen.
Die Proteste in Iran wurden von der iranischen Regierung mit brutaler Gewalt beantwortet. Sie begannen in Reaktion auf den Mord an Jîna Mahsa Amini, einer 22-jährigen iranischen Kurdin, die von der islamischen „Sittenpolizei“ getötet wurde. Viele Frauen und Aktivist*innen wurden verhaftet, inhaftiert, gefoltert und ermordet. Die Proteste sind ein Kampf für die Befreiung der Frauen von einem patriarchalen Zwangsregime, das auf ihre Körper, auf ihre Wünsche, auf ihr Leben zugreift. Vom obligatorischen Kopftuch bis hin zum eingeschränkten Zugang zu Bildung und zu Beschäftigungsmöglichkeiten werden Frauen systematisch unterdrückt, zum Schweigen gebracht und müssen ein benachteiligtes Leben führen. Die in Iran patriarchal-religiös strukturierte Familie ist für die Ideologie der islamischen Republik zentral. Die familiäre Gemeinschaft dient als Gegenbild zum dämonisierten westlichen Kapitalismus und soll den Individuen trotz ökonomischer Unsicherheit Halt und identitäre Orientierung bieten.
Die Proteste in Iran verbinden soziale Kämpfe intersektional miteinander und streben so einen Systemwandel an: Sie verbinden den Kampf gegen patriarchale Unterdrückung mit dem Kampf für politische Freiheit und Aufbegehren gegen religiöse Herrschaft mit der Ablehnung kapitalistischer Ausbeutung. Das Kopftuch ist dabei zum Symbol dieser Proteste geworden. Die iranische Feministin Masih Alinejad, die seit 2009 in den USA im Exil lebt und immer wieder den Auftragsmördern des iranischen Regimes entkommen muss, nennt das Kopftuch „die wichtigste Säule der religiösen Diktatur“. Das Ablegen, Abwerfen oder Verbrennen des Kopftuchs ist zum Symbol für weibliche Selbstbestimmung, ein Ausdruck des Ausrufes „My Body, My Choice“ geworden. Die Proteste sind außerdem ein Kampf gegen das kapitalistische Patriarchat: Streiks und Arbeitskämpfe gegen kapitalistische Produktionsverhältnisse sind ein zentrales Element der Proteste. Die Arbeiter*innenschaft ist immanenter Bestandteil der Protestbewegung. Der iranische Protest, der es schafft, Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen zu bekämpfen und diese im Kampf miteinander zu verbinden, zeigt, dass der Kampf für weibliche Selbstbestimmung intersektional geführt werden und es ihm dabei um die grundsätzliche Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der kapitalistischen Moderne gehen muss. Dafür müssen die gegenseitige Durchdringung und Überlagerung von Ideologien herausgearbeitet werden und für einen Kampf gegen diese Ideologien und Herrschaftsformen fruchtbar gemacht werden.
Aus dem intersektionalen iranischen Kampf sollten wir daher lernen: Gegen internationale patriarchale Unterdrückung und Unterwerfung zu kämpfen, heißt die Rolle des religiösen Fundamentalismus und dessen Einbettung in kapitalistische Produktionsverhältnisse zu erkennen. Feministinnen in Deutschland sollten von den Protesten in Iran folglich lernen, religiöse Identitätspolitiken nicht zu unterstützen, das Kopftuch nicht zum anti-westlichen Widerstandssymbol zu verklären und vor allem nicht die patriarchale Unterdrückung zu verkennen, die vom islamischen Fundamentalismus auch in deutschen Moscheen ausgeht. Das heißt: Weil wir der Ansicht sind, dass Religion und die ökonomischen Rahmenbedingungen der Gesellschaft mit dem Patriarchat verwoben sind, sollte ein intersektionaler feministischer Kampf gleichzeitig ein Kampf für eine säkulare Gesellschaft und für die Überwindung kapitalistischer Produktions- und Herrschaftsverhältnisse sein.
Doch die Spezifik der iranischen Kämpfe darf nicht unbeachtet bleiben und sie dürfen nicht umstandslos auf die Kämpfe in Deutschland umgemünzt werden. Dass politische Debatten um das Kopftuch in Deutschland von Rassismus und Sexismus geprägt sind, sollte stets herausgearbeitet werden: Warum muslimisch geprägte Symbole und religiöse Unterdrückung kritisiert werden, sollte stets hinterfragt werden.
Als Feminist*innen müssen wir uns mit internationalen emanzipatorischen Kämpfen solidarisch zeigen und uns mit diesen Kämpfen in Bezug setzen. Nicht nur heute, sondern alle Tage. Für den Sieg der iranischen Revolution, Jin Jiyan Azadi!
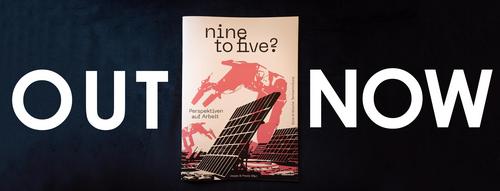
Unsere Broschüre “nine to five? – Perspektiven auf Arbeit” ist endlich da!
Lieben Dank an die Autor*innen und Zusammenschlüsse Pünktchen Biberkopf und Spektakel, Emanzipative Antifaschistische Gruppe (EAG Berlin), Anna Kow und Virginia Kimey Pflücke (A.V. Schmidt), Tina Sanders, Lothar Galow-Bergemann, Amici della Conricerca und GuTso sowie unsere Interviewpartner, Lorenz vom CAT-Kurierkollektiv und Arthur, einen ehemaligen Rider, die durch ihre Beiträge und Expertisen diese Textsammlung bereichern. Ebenso herzlich danken möchten wir der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die finanzielle Unterstützung durch eine Förderung unseres Projektes und E. für das Layout der Broschüre.
Jetzt möchten wir euch die Broschüre nicht länger vorenthalten, ihr findet eine Version zum Anfassen vielleicht bald bei einigen Läden in Leipzig, stay tuned.
Eine digitale Version findet ihr hier:
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Hey, wir sind von Utopie und Praxis Leipzig und wollen uns heute im nachfolgenden Redebeitrag etwas wegbewegen von den genauen Geschehnissen in Nahost hin zum Verhältnis der hiesigen Linken zu Israel.
Wenn man sich dieser Tage durch die Sozialen Medien bewegt, begegnen einem schnell die krudesten Behauptungen, Verfälschungen und Narrative, welche doch von einer geradezu erschreckenden Ignoranz zeugen, mit der antisemitische Ressentiments nett umschmückt in Infografiken verbreitet werden.
Auch in scheinbar neutral daherkommenden Posts à la “man möchte ja keine Partei ergreifen, beide Seiten sind irgendwie schwierig” sehen wir eine große Gefahr. Schon allein die Gleichstellung der Angriffe der Hamas, einer islamistischen Terrororganisation, welche antisemitische Vernichtungsphantasien propagiert, mit der israelischen Selbstverteidigung ist untragbar. Diese Dynamik konnte auch in den Kommentarspalten und Telegram-Gruppen beobachtet werden, in denen diese Kundgebung beworben wurde. Die Feststellung, dass Israel ein bürgerlicher Rechtsstaat, mit all seinen Unzulänglichkeiten ist, wird hier zu Gunsten der Legitimierung freiheitsfeindlicher Ansichten aufgegeben.
Das unverrückbare Existenz- und Selbstverteidigungsrecht Israels als jüdischer Schutzraum kommt vielen selbsternannten Linken nicht über die Lippen, ohne mit einem Whataboutism anzufangen. Dabei wird sonst immer schnell entschieden Partei ergriffen für Menschen die Diskriminierung erfahren – und das soll auch weiterhin so bleiben – die Frage, wo die Solidarität mit den Menschen bleibt, die in Israel beschossen werden, aber auch denen, die sich in Gaza der Hamas entgegenstellen und dafür um ihr Leben fürchten müssen, bleibt oftmals unbeantwortet.1
Continue reading “Redebeitrag 15.05.21 // Kundgebung “Gegen jeden Antisemitismus – Solidarität mit Israel””